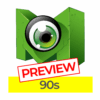-
 play_arrow
play_arrowTophits Charts & Hits
-
 play_arrow
play_arrowDance Dance Hits & Classics
-
 play_arrow
play_arrowEvergreens Best of 60's - 00's
-
 play_arrow
play_arrow90’s Dein 90er Throwback
-
 play_arrow
play_arrow2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
-
 play_arrow
play_arrowRock Finest Rock Music
-
 play_arrow
play_arrowSchlager Deutscher Schlager

Autonomes Fahren hat in den vergangenen Jahren eine Entwicklung von ambitionierten Laborversuchen bis hin zu konkreten Pilotprojekten und ersten Testflotten vollzogen. Robotaxis spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie verknüpfen die Fortschritte in den Bereichen Sensorik, KI und Software mit den durch die Fahrdienste Uber oder Lyft bekannt gewordenen und etablierten Ride-Hailing-Geschäftsmodellen. Trotz anhaltender Debatten über die Sicherheit und die Haftung im Schadensfall treiben Tesla, Volkswagen und weitere Hersteller die Entwicklung von Robotaxis weiter voran.
Teslas Pilotbetrieb in Austin – Robotaxis im urbanen Umfeld
 Seit Juni 2025 ist auf einer kleinen Fläche in Austin, Texas, eine erste Flotte speziell umgerüsteter Model-Y-Fahrzeuge von Tesla unterwegs. Die Autos fahren selbstständig – es sitzt aber noch Sicherheitspersonal im Wagen, das notfalls eingreift. Der Testbetrieb in Austin soll vor allem die rein kamerabasierten Full-Self-Driving-Technologie („Vision-only“) von Tesla in einer für die Technik komplexen Innenstadtumgebung trainieren. Tesla-CEO Elon Musk kündigte an, die Self-Driving-Software bis Ende 2026 „auf Millionen bestehender Tesla-Fahrzeuge“ aufzuspielen und so schlagartig einen globalen Robotaxi-Dienst zu schaffen.
Seit Juni 2025 ist auf einer kleinen Fläche in Austin, Texas, eine erste Flotte speziell umgerüsteter Model-Y-Fahrzeuge von Tesla unterwegs. Die Autos fahren selbstständig – es sitzt aber noch Sicherheitspersonal im Wagen, das notfalls eingreift. Der Testbetrieb in Austin soll vor allem die rein kamerabasierten Full-Self-Driving-Technologie („Vision-only“) von Tesla in einer für die Technik komplexen Innenstadtumgebung trainieren. Tesla-CEO Elon Musk kündigte an, die Self-Driving-Software bis Ende 2026 „auf Millionen bestehender Tesla-Fahrzeuge“ aufzuspielen und so schlagartig einen globalen Robotaxi-Dienst zu schaffen.
Fachleute zweifeln, dass der aggressive Zeitplan von Elon Musk und Tesla realistisch ist. Ohne Lidar- oder Radar-Sensoren müssen die neuronalen Netze der Self-Driving-Software sämtliche Verkehrsszenarien ausschließlich aus Kamerabildern ableiten – ein Ansatz, der bei Nacht, Nebel oder grellem Gegenlicht bislang Schwächen zeigt, die abgestellt werden müssen. Regulatorisch bewegt sich das Vorhaben ebenfalls auf dünnem Eis: In Texas gelten liberale Regeln. Es reicht derzeit eine einfache Registrierung, eine formale Sicherheitszertifizierung ist nicht vorgeschrieben. Ein Roll-out in anderen Teilen der Welt und insbesondere in Europa würde deshalb ganz neue Sicherheitsnachweise und Typgenehmigungen erfordern, bevor entsprechende Robotaxi-Dienste starten könnten.
Volkswagen & Uber – der ID. Buzz AD als transatlantisches Pilotprojekt
Volkswagen verfolgt einen anderen Weg als Tesla. Gemeinsam mit der Konzerntochter MOIA entwickelt der Hersteller den ID. Buzz AD, ein von Grund auf als hochautomatisiertes (Level 4) Robotaxi konstruiertes Fahrzeug. 13 Kameras, neun Lidar-Sensoren und ein zentraler Mobileye-Chipsatz sollen das autonome Fahren ermöglichen. Nach mehrjährigen kleinen Praxistests soll ab 2026 eine erste Testflotte in Zusammenarbeit mit dem Fahrdienst Uber zunächst in Los Angeles und später auch in deutschen Städten eingesetzt werden.
Die Aufgabenverteilung der Partnerschaft lehnt sich an die Plattformlogik des Wolfsburger Konzerns an: VW liefert die Hardware, die Autonomie-Software und die Flottensteuerung – Uber steuert unter anderem die Kundschaft, die App-Infrastruktur und die Zahlungsabwicklung bei. Laut Konzernplanungen könnten bis 2030 allein in den USA „mehrere tausend“ ID. Buzz AD autonom unterwegs sein. Für den Start im Jahr 2026 ist aus regulatorischen Gründen noch ein Sicherheitsfahrer vorgesehen – vollständig autonome Fahrten peilt VW ab 2027 an.
Weltweiter Wettbewerb: Waymo, Baidu und Cruise
Neben Tesla und Volkswagen positionieren sich weitere Hersteller und Firmen im Robotaxi-Markt. Die Google-Tochter Waymo betreibt bereits in den US-Städten Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin und Atlanta im kleinen Maßstab vollautonome Ride-Hailing-Dienste. Im Juli 2025 starteten sogenannte „Roadtrips“ nach Philadelphia und New York, um aktuelles Kartenmaterial zu sammeln und eine Testlizenz an der US-Ostküste vorzubereiten. Parallel entsteht in Phoenix eine eigene Fertigung, die Waymo-Technologie in Elektrofahrzeuge von Jaguar und Zeekr integriert.
In China expandiert Baidu mit „Apollo Go“: Gemeinsam mit dem Autovermieter CAR Inc. wurde bereits ein erstes Mietangebot gestartet, bei dem Nutzerinnen und Nutzer Robotaxis für mehrere Stunden oder Tage buchen können. China definiert staatlich großflächige Pilotzonen und lässt Regulierungsbehörden eng mit Unternehmen im Bereich Mobilität und Self Driving kooperieren – das verschafft den chinesischen Herstellern und Plattformen gute Ausgangsbedingungen.
General Motors musste einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem schweren Unfall im Herbst 2023 entzog der US-Bundesstaat Kalifornien der Tochter „Cruise“ die Genehmigung für den Einsatz von selbstfahrenden Autos. Der Mutterkonzern GM legte daraufhin die Produktion einer neuen Fahrzeug-Generation ohne Lenkrad und Pedale vorerst auf Eis. Teile der entwickelten Technologie sollen aber in die Fahrerassistenzsysteme für GM-Serienmodelle einfließen.
Risiken und Chancen des autonomen Fahrens
Mehr Verkehrssicherheit
Das wichtigste Versprechen des autonomen Fahrens lautet: weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Laut Factsheet der University of Michigan könnten autonome Fahrzeuge bis zu 90 % aller Unfälle vermeiden, da sie menschliches Fehlverhalten eliminieren. Waymo stützt diese These mit eigenen Daten: Nach 56,7 Millionen rein autonomen Meilen verzeichnete das Unternehmen 92 % weniger Fußgänger- und 96 % weniger Kreuzungskollisionen im Vergleich zu menschlichen Fahrern. Langzeitstudien – insbesondere in der Fläche – existieren jedoch bisher nicht.
Technische und operative Risiken
Hardware-Ausfälle, Sensorblindheit bei Starkregen oder Schneefall sowie Cyberangriffe sind naheliegende Schwachstellen von selbstfahrenden Autos und Robotaxis. Außerdem lernt auch die beste KI nur aus realen Fällen, mit denen sie trainiert wurde: selten und teilweise hochkomplexe Ausnahmefälle – etwa falsch platzierte Baustellenschilder – können zu falschen Reaktionen und Fehlern führen.
Gesellschaftliche und ökonomische Effekte
Robotaxis versprechen weniger Staus, geringere Parkraumnachfrage und neue Mobilitätsoptionen – sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum. Gleichzeitig stehen weltweit mehrere Millionen Beschäftigte im Taxi-, Ride-Hailing- und Logistiksektor unter einem Rationalisierungsdruck durch die neue Technologie – sie haben Angst um ihre Jobs. Experten gehen jedoch von einer jahrzehntelangen Übergangsphase aus, in der autonome und manuelle Dienste koexistieren.
Regulatorischer Balanceakt
Der Gesetzgeber muss einerseits Innovation ermöglichen und andererseits gleichzeitig Haftungs- sowie Datenschutzfragen klären. Deutschland plant, mit dem Gesetz zum autonomen Fahren ab 2027 Level-4-Flotten ohne Sicherheitsfahrer zu erlauben, fordert aber eine Black-Box-Aufzeichnung und eine Remote-Leitstelle, die im Extremfall eingreifen kann. In den USA bleibt ein Flickenteppich staatlicher Regeln bestehen, während China zentral gesteuerte Pilotzonen nutzt, um Technik und den Markt schneller zusammenzuführen.
Fazit
2025 markiert möglicherweise einen Wendepunkt beim autonomen Fahren und Robotaxis: Die Technik ist trotz einiger Kinderkrankheiten grundsätzlich für Pilotprojekte und Erprobungen in der Fläche einsatzbereit, aber der großflächige Roll-out scheitert in vielen Fällen noch an regulatorischen Vorgaben und auch an der gesellschaftlichen Akzeptanz. Deshalb bleibt es vorerst bei Tests in kleinen, klar abgesteckten Testgebieten – oft noch mit Sicherheitspersonal an Bord. Technisch zeichnet sich ein Wettlauf ab. Tesla setzt auf schnelle Software-Skalierung, Volkswagen hingegen zielt auf eine vertikal integrierte Komplettlösung in Zusammenarbeit mit einem etablierten Plattform-Partner ab. Ob Robotaxis den Verkehr revolutionieren oder eine Nischenlösung bleiben, entscheidet sich in den kommenden Jahren – auf den Straßen, in den Aufsichtsbehörden und in der Gesellschaft.
Geschrieben von: admin
Beliebt
2. Bundesliga 3. Liga Abstiegskampf ARD Aufstiegskampf Bertrand Piccard Bundesliga CDU Champions-League Champions League Deutsche Musik FC Barcelona FC Bayern München Hollywood Klimawandel Konzerte Luisa Neubauer Musikfestival Musikindustrie Popmusik Premier League Prominente RTL Schlager SPD Technologie
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!